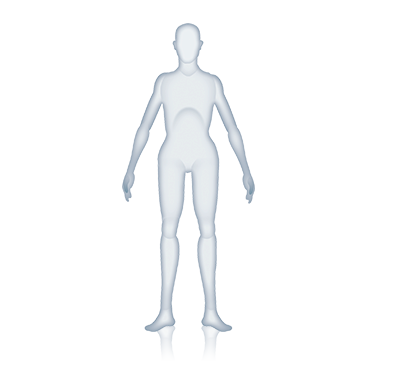Medizinische Informationen zu Gallenblasenoperationen
Die Gallenblase befindet sich unterhalb der Leber im rechten Oberbauch. Sie dient als Speicher für die von der Leber gebildete Gallenflüssigkeit. Die Flüssigkeit wird bei Bedarf, etwa zur Verdauung fetthaltiger Nahrungsmittel, über die Gallengänge in den Dünndarm abgegeben.
Risikofaktoren
In der Gallenblase können sich Steine bilden – meist dadurch, dass in der Gallenflüssigkeit enthaltenes Cholesterin kristallisiert. Eine fette, cholesterinreiche und ballaststoffarme Ernährung, Übergewicht sowie Diabetes gelten als größte Risikofaktoren. Hinzu kommen mögliche familiäre Vorbelastung, fortschreitendes Alter sowie die Einnahme von Östrogen, etwa zur Verhütung oder zur Hormontherapie in den Wechseljahren. Frauen sind zwei bis dreimal häufiger betroffen als Männer, 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung insgesamt haben Gallensteine.
Symptome
Beschwerden machen die Steine nur bei etwa 20 bis 25 Prozent der Betroffenen. Sie verursachen dann unter Umständen heftige, krampfhafte Schmerzen im rechten Oberbauch – die so genannten Gallenkoliken. Wenn Steine sich lösen, in den Gallengang wandern und den Abfluss der Gallenflüssigkeit behindern, macht sich dies mit einer Gelbfärbung von Augen und Haut sowie einer Dunkelfärbung des Urins bemerkbar. Im Falle einer Gallenblasenentzündung (Cholezystitis) kommt es neben anhaltenden Schmerzen zu Fieber, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Dann muss akut gehandelt werden. Bricht die entzündete Gallenblase auf, breitet sich die Flüssigkeit im Bauchraum aus und kann eine Bauchfellentzündung (Peritonitis) hervorrufen. Gehen die Bakterien ins Blut über, droht sogar eine lebensbedrohliche Blutvergiftung (Sepsis). Daher ist bei einer Gallenblasenentzündung in der Regel die umgehende Entfernung der Gallenblase angezeigt. Aber auch bei Gallenkoliken bietet eine Operation meist die besten Erfolgsaussichten.
Diagnose
Gallensteine und eine eventuell vergrößerte und entzündete Gallenblase lassen sich sehr zuverlässig mit einer Ultraschalluntersuchung feststellen, eine Entzündung außerdem anhand bestimmter Blutwerte. Mitunter wird auch eine Spiegelung der Gallengänge (Fachbegriff ERCP = Endoskopisch-retrograde Cholangio-Pankreatikographie) durchgeführt, um die Situation dort genauer betrachten zu können. Dabei wird unter Schlafnarkose ein feiner biegsamer Schlauch mit einer Lichtquelle und einer Mikrokamera durch Mund, Speiseröhre und Magen bis zu den Gallengängen vorgeschoben. Mithilfe eines Auffangkörbchens können Steine sogar gleich aufgegriffen und aus dem Gallengang entfernt werden.
Therapie
Mit der Entfernung der Steine allein – auch durch Medikamente oder Stoßwellen – ist in der Regel aber kein dauerhafter Behandlungserfolg zu erzielen. Deshalb raten Ärzte in der Regel zu einer Operation, bei der die Gallenblase vollständig entfernt wird. Dadurch wird in aller Regel auch einer erneuten Steinbildung vorgebeugt.
Bei über 90 Prozent dieser Eingriffe kann auf einen offenen Bauchschnitt verzichtet werden; die Operation erfolgt „durchs Schlüsselloch“. Dabei verschaffen sich die Chirurgen mit einem zwei Zentimeter kurzen Hautschnitt im Bereich des Nabels Zugang zum Bauchraum. Über dieses „Schlüsselloch“ wird ein so genanntes Laparoskop in die Bauchhöhle eingeführt, ein dünner Hohlstab mit einer Videokamera an der Spitze, die hochauflösende Bilder aus dem Körperinneren auf einen Monitor überträgt. Über wenige weitere kleine Schnitte werden dann spezielle Greif- und Schneideinstrumente in die Bauchhöhle eingebracht, mit denen die eigentliche Operation durchgeführt wird. Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose und dauert etwa eine Dreiviertelstunde.
Risiken während und nach Operation
Die Entfernung der Gallenblase ist heute ein weit verbreiteter Routineeingriff, bei dem es nur selten zu Komplikationen wie Blutungen oder Infektionen kommt. Für die Patienten ist der Verlust des Organs nicht spürbar. Die Gallenflüssigkeit gelangt künftig direkt über die Gallengänge in den Darm. Nach der Behandlung kann jeder sein gewohntes Leben wieder aufnehmen. Von ärztlicher Seite empfohlen wird jedoch in den ersten Wochen nach der Operation eine leicht verdauliche, fettarme Ernährung. Nach der Anpassungsphase ist in den allermeisten Fällen eine normale, ausgewogene Ernährung möglich.